- Kanzlei
- Rechtsanwälte
- Rechtsanwalt Arno Stengel
- Rechtsanwalt Harald Federle
- Rechtsanwalt Thomas Hess
- Rechtsanwalt Stefan Wahlen
- Rechtsanwalt Hannes Linke
- Rechtsanwalt Prof. Dr. Stefan Jäger
- Rechtsanwalt Stefan Neumann
- Rechtsanwalt Nicolai Funk
- Rechtsanwältin Susanne Bellemann-Ruppel (Of Counsel)
- Rechtsanwalt Heiko Graß
- Rechtsanwalt Peter Sennekamp
- Rechtsanwalt Christian Thome
- Rechtsanwalt Dr. Georg Wirtz LL.M.
- Rechtsanwalt Frank Rief
- Rechtsanwältin Stefanie Kowalke-Reich LL.M.
- Rechtsanwalt Marc-Yaron Popper LL.M.
- Rechtsanwältin Elisa Moch
- Rechtsanwalt Dominik Baier
- Rechtsanwältin Claudia Stock
- Rechtsanwalt Maximilian Gehbauer
- Steuerberatung
- Rechtsgebiete
- Arbeit & Soziales
- Bauen, Immobilien und Miete
- Bürger, Staat und Kommunen
- Ehe, Familie und Scheidung
- Erben und Vererben
- Gewerblicher Rechtsschutz
- Urheber- und Medienrecht
- Haftung, Schaden und Verkehr
- Wirtschaftsrecht und Handelsrecht
- Insolvenz, Restrukturierung und Unternehmenssanierung
- Kapital, Banken und Börsen
- Medizin und Recht
- Öffentlicher Dienst und Beamte
- Schule, Hochschule und Bildung
- Strafrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht
- Umweltrecht und Planungsrecht
- Versicherungen
- BLOG | Aktuelles
- Download
- Karriere
- Gläubigerinformationssystem
- Kontakt
Aufgepasst bei Bescheiden über die Rückforderung von Versorgungsbezügen durch das Landesamt für Besoldung und Versorgung (LBV)!
Zu hohe Rückforderung von Versorgungsbezügen?

Beim Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Renten kann es für viele Ruhestandsbeamte des Landes Baden-Württemberg zu einer unangenehmen Überraschung kommen. Die Versorgungsbezüge ruhen nämlich unter Umständen in Höhe der bezogenen Rente. Ist dieses Ruhen der Versorgungsbezüge bisher vom LBV nicht festgestellt worden, drohen hohe Rückforderungen der schon jahrelang ausgezahlten Versorgungsbezüge.
Mit dem Dienstrechtsreformgesetz sollte in Baden-Württemberg 2011 (auch) eine Trennung der Alterssicherungssysteme von Beamten und gesetzlicher Rente herbeigeführt werden. Da diese Trennung in erster Linie in der Zukunft erreicht werden sollte, stellt sich die Frage, wie mit Ruhestandsbeamten, die neben ihren Versorgungsbezügen Renten beziehen, und Beamten, die damals schon Rentenanwartschaften erworben haben, umzugehen ist. Hierzu wurde mit § 108 BeamtVG BW eine Regelung geschaffen, die vorsieht, dass der Versorgungsbezug teilweise ruht, wenn er gemeinsam mit der bezogenen Rente eine sich nach einem fiktiven Ruhegehalt richtende Höchstgrenze überschreitet. Dies kann unter Umständen dazu führen, dass das Ruhegehalt in der vollen Höhe der daneben bezogenen Rente ruht und von den erworbenen Rentenanwartschaften im Alter faktisch keine Vorteile verbleiben. Ein Vorgehen gegen die Feststellung des Ruhens der Versorgungsbezüge verspricht aber in den meisten Fällen keinen Erfolg. Der Gesetzgeber ist durch die Verfassung anerkanntermaßen nicht daran gehindert, ein derartiges Ruhen der Versorgungsbezüge anzuordnen. Wenn und sobald daher das Landesamt für Besoldung und Versorgung (LBV) davon Kenntnis erlangt, dass Ruhestandsbeamte oder sonstige Versorgungsempfänger neben Ihrer Versorgung Renten beziehen, wird es das teilweise Ruhen der Versorgungsbezüge feststellen. Diese Kenntnis erlangt das LBV in der Regel durch die Versorgungsempfänger selbst, die verpflichtet sind, dem LBV jede Änderung von Leistungen i. S. d. § 108 BeamtVG mitzuteilen. Aus verschiedenen Gründen kommt es aber häufig dazu, dass die Versorgungsempfänger diese Mitteilung an das LBV irrtümlich unterlassen. Die Versorgungsbezüge werden in diesen Fällen unter Umständen jahrelang ungekürzt ausgezahlt.
Sobald das LBV von der Überzahlung Kenntnis erlangt, können aber hohe Rückforderungen drohen.
Das LBV arbeitet derzeit einen Bearbeitungsrückstau auf und stellt vermehrt Anfragen an die Deutsche Rentenversicherung, um in Erfahrung zu bringen, ob die Versorgungsempfänger des Landes neben ihrer Versorgung Renten beziehen. Im Rahmen dieser Abfragen erfährt das LBV nicht selten, dass tatsächlich Renten neben der Versorgung bezogen werden und wurden. Es kam daher in letzter Zeit vermehrt zu Rückforderungen der überzahlten Versorgung, die im niedrigen bis mittleren fünfstelligen Bereich liegen, und die Betroffenen in ihrer finanziellen Lebensplanung im Alter unvorhergesehen treffen. Die Rückforderung wird zwar in der Regel gestundet und soll mit dem Versorgungsbezug über mehrere Monate verrechnet werden. Eine monatliche Verringerung des Versorgungsbezugs von mehreren hunderten Euro trifft die meisten Betroffenen aber dennoch hart.
Bei der Rückforderung dieser Bezüge durch Rückforderungsbescheid setzt das LBV die Rückforderungen jedoch in nicht wenigen Fällen erheblich zu hoch an. Diese sind oft um mindestens die Hälfte zu reduzieren, sodass die finanziellen Folgen für Betroffene nicht unwesentlich abgemildert werden können.
Wenn auch Sie sich Rückforderungen des LBV wegen einer neben einer Versorgung bezogenen Rente ausgesetzt sehen, oder sich dahingehend proaktiv beraten lassen wollen, zögern Sie nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen und sich hinsichtlich der Erfolgsaussichten eines Vorgehens gegen die Rückforderung beraten und bei der Durchsetzung Ihrer Rechte unterstützen zu lassen.
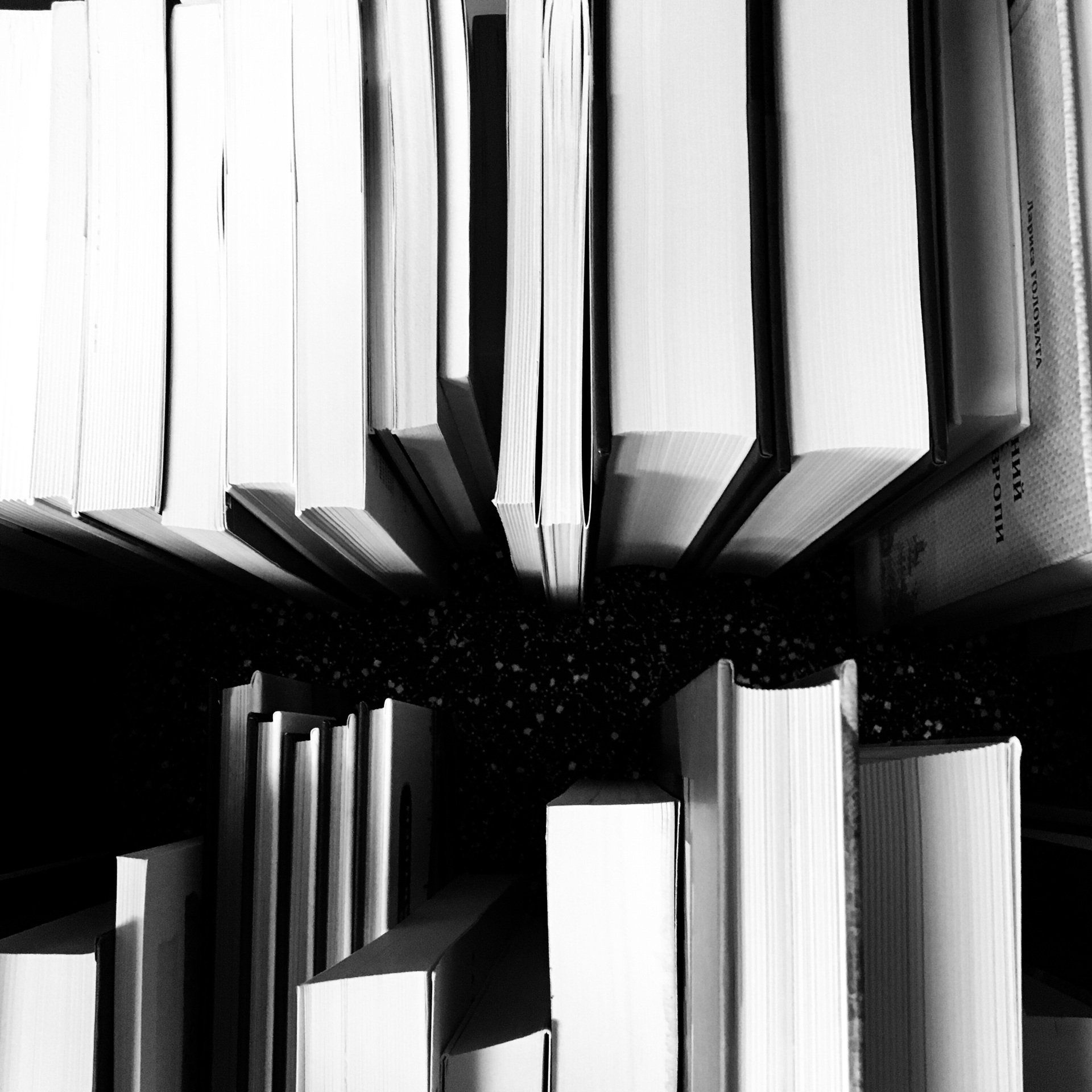
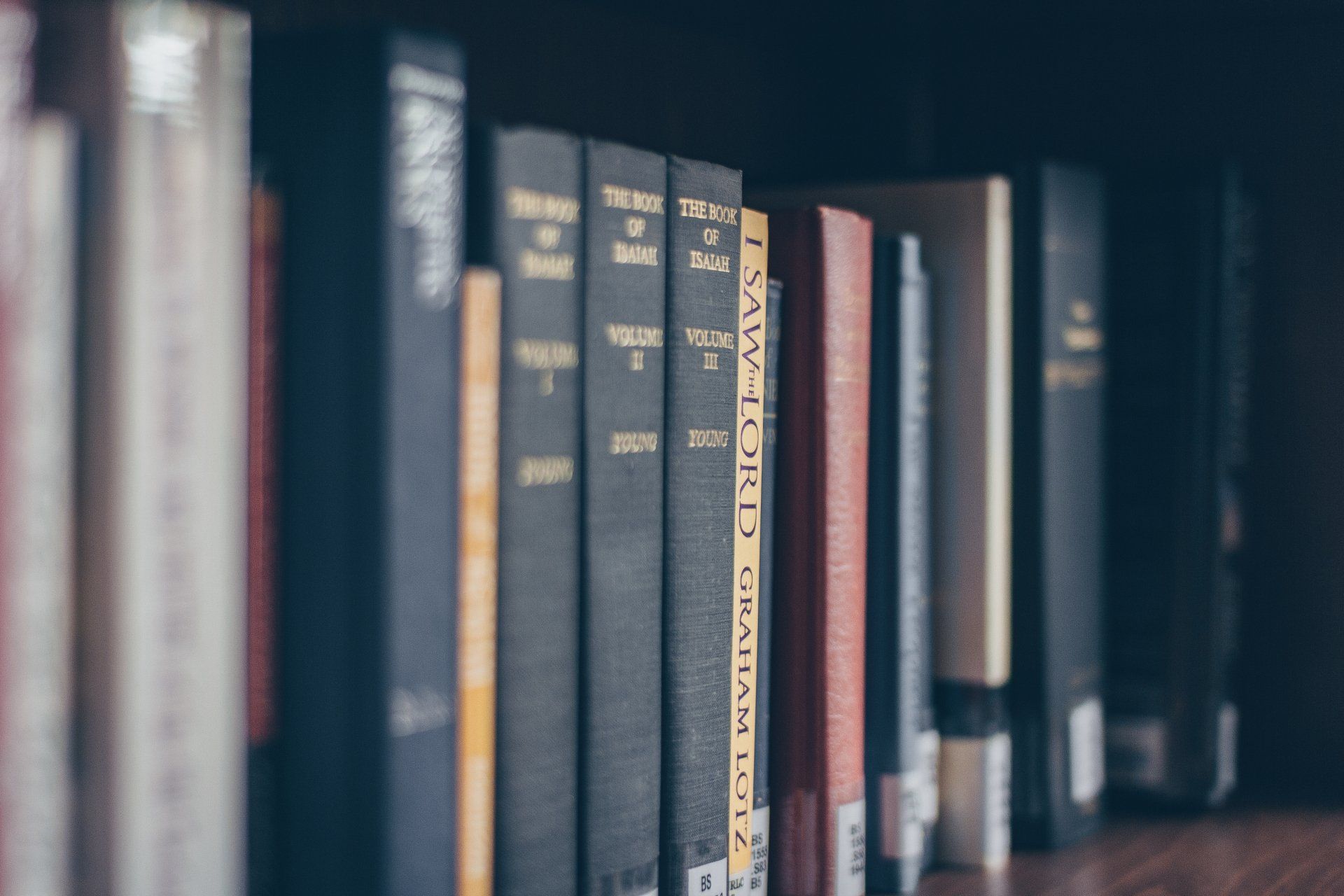



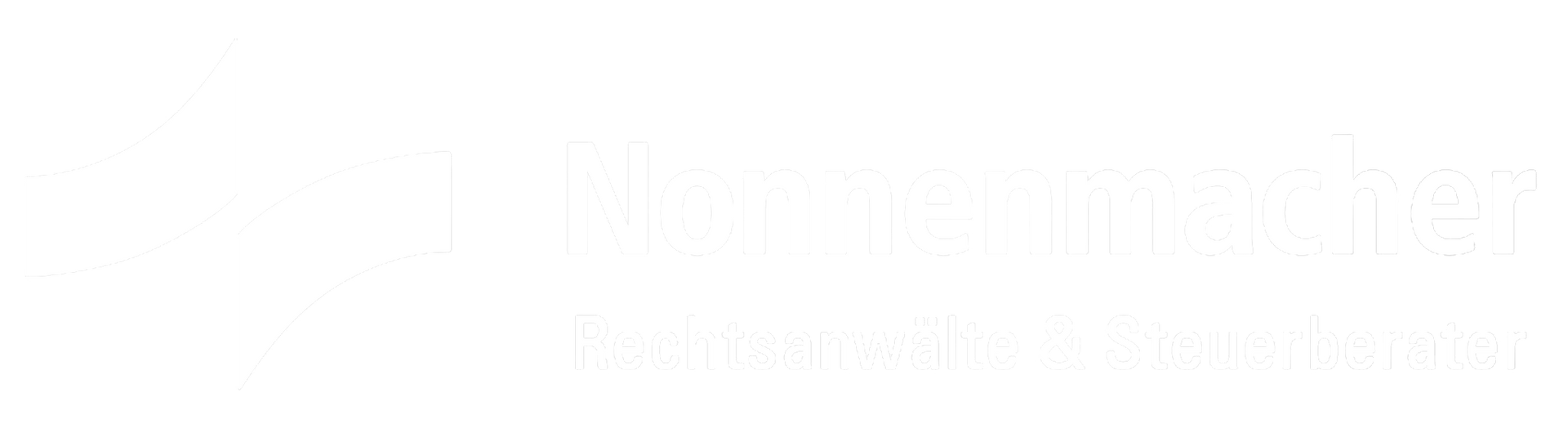
Nonnenmacher Rechtsanwälte Part mbB
Wendtstr. 17
76185 Karlsruhe
Tel.: 0721-985220
Fax: 0721-9852250
E-Mail:
rechtsanwaelte@nonnenmacher.de




